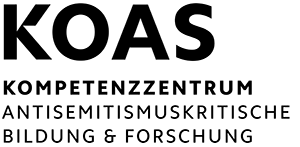Die analogen und digitalen Bildungsprogramme des KOAS sind auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten und werden bundesweit als mehrteilige Seminare, einzelne Workshops und Vorträgen umgesetzt. Sie basieren auf den KOAS-Bildungsansätzen, orientieren sich an Qualitätsmerkmalen antisemitismuskritischer Bildung und werden kontinuierlich weiterentwickelt und ergänzt. Interne Austauschräume sowie Formate für die eigene Praxisreflexion unterstützen die Bildungsreferent*innen des KOAS und tragen zur Qualitätssicherung der Bildungsarbeit bei.
Antisemitismus ist in allen gesellschaftlichen Bereichen anzutreffen und stellt für Jüdinnen_Juden eine alltagsprägende Konstante dar. Die fortwährende ›Perspektivendivergenz‹ (vgl. Antisemitismusbericht 2018: 93) in der Wahrnehmung und Einordnung von Antisemitismus in der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft trägt, zuweilen ungewollt, zur Aufrechterhaltung antisemitischer Strukturen bei. Antisemitismuserfahrungen werden wiederholt bagatellisiert, entideologisiert und umgedeutet, was einem wirksamen antisemitismuskritischen Handeln entgegensteht. Das Bildungsprogramm »Antisemitismus als Erfahrung und Struktur« thematisiert Kontinuitäten, Brüche, Leerstellen, Funktionen und Wirkungen des Gegenwartsantisemitismus. Es sensibilisiert für ein erweitertes Verständnis von Antisemitismus als historisch angelegtes Gewalt- und Ungleichheitsverhältnis. Die Teilnehmenden haben die Gelegenheit, ihre Beziehung zu Antisemitismus zu reflektieren und die Traditionslinien des gesellschaftlichen und pädagogischen Umgangs mit Antisemitismus nach 1945 in Verbindung zu bringen. Das Programm fördert die (Weiter-)Entwicklung einer antisemitismuskritischen Haltung und Praxis.
WEITERFÜHRENDE HINWEISE:
Chernivsky, Marina / Lorenz-Sinai, Friederike (2022): Perspektivendivergenz in der Antizipation und
Einordnung antisemitischer Gewalt im Kontext Schule in Jüdisches Leben in Deutschland.
in: bpb – Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), APuZ – Aus Politik und Zeitgeschichte,
Schriftenreihe Band 10799
Die Diskussion um Antisemitismus an Schulen steht meistens im Zusammenhang mit medial geführten Debatten um einzelne schulische Vorfälle. Dabei werden vornehmlich Schüler*innen in den Fokus gerückt. Allerdings sind auch Lehrer*innen an der Reproduktion von Antisemitismus maßgeblich beteiligt. Die Bandbreite der von Betroffenen wie auch von Lehrkräften geschilderten antisemitischen Dispositionen reichen von Andeutungen, Zuschreibungen, (verbalen) Übergriffen bis hin zu psychischer und physischer Gewalt, Benachteiligung, Diskriminierung und institutionellem Antisemitismus (vgl. Chernivsky / Lorenz-Sinai 2024). Lehrkräfte sind daher gefordert, auf die gewaltförmige Struktur des Antisemitismus zu reagieren und wirksam zu handeln. Das Bildungsprogramm unterstützt Lehrkräfte, Krisenteams, Schulleitungen und weitere schulnahe Akteur*innen bei der Entwicklung und Implementierung von wirksamen Ansätzen im Umgang mit Antisemitismus an Schulen. Die Teilnehmenden werden in die Grundprinzipen antisemitismuskritischer Bildung eingeführt und entwickeln auf dieser Basis ihre pädagogischen Strategien und Interventionen weiter.
WEITERFÜHRENDER HINWEIS:
Chernivsky, Marina / Lorenz-Sinai, Friederike (2024): Institutioneller Antisemitismus in der Schule.
in: Baustein 14, Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage. Aktion Courage e.V., Berlin.
Antisemitismus manifestiert sich tagtäglich in unterschiedlichen Erscheinungsformen. In der Schule offenbart sich Antisemitismus als systemische Herausforderung und bleibt dennoch oftmals unbearbeitet. Ein professioneller Umgang muss daher mehr umfassen als eine schüler*innenzentrierte Problematisierung. Das im Zentrum der Fortbildung stehende Unterrichtsmaterial (entwickelt vom Kompetenzzentrum und dem German Desk der International School of Holocaust Studies Yad Vashem) bietet Lehrer*innen daher einerseits die Möglichkeit, die eigene Wahrnehmung und Einordnung von Antisemitismus zu schärfen und die individuelle Interventionskompetenz zu erweitern. Andererseits bietet das Unterrichtsmaterial auch die Chance, Antisemitismus anhand von konkreten Fällen mit Schüler*innen besprech- und bearbeitbar zu machen. Die Funktionen von Antisemitismus und seine Wirkung auf Betroffene, insbesondere im Kontext Schule, stehen dabei im Vordergrund. Die Fortbildung bietet den Teilnehmer*innen die Möglichkeit, das Unterrichtmaterial kennenzulernen und mit Qualitätskriterien vertraut zu werden, die für einen professionellen Umgang mit Antisemitismus essenziell sind. Das Unterrichtsmaterial wird für den Einsatz ab der 8. Klassenstufe empfohlen.
WEITERFÜHRENDER HINWEIS:
Chernivsky, Marina / Hartmann, Deborah / Klammt, Beate / Mkayton, Noa / Rachow, Esther/ Scheuring, Jana / Wiegemann, Romina (2021): Antisemitismus? Gibt’s hier nicht. Oder etwa doch?
in: Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment / Yad Vashem. ISBN: 978-965-525-109-8
Das Verschwörungsdenken ist integraler Bestandteil des Antisemitismus, wie zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt hat. Es entsteht aber nicht erst in Krisensituationen, sondern ist seit dem Mittelalter Teil der gesellschaftlichen Tiefenstruktur. Auf Verschwörungserzählungen kann jederzeit zurückgegriffen werden, um unverstandene und bedrohliche Entwicklungen zu erklären. Sie haben dadurch eine stabilisierende und beruhigende Wirkung auf ihre Anhänger*innen, mithin einen Mehrwert. Zugleich markieren sie ein Feindobjekt, an dem Aggression und Gewalt ausagiert werden können. Dies macht Verschwörungserzählungen so gefährlich. Ob im beruflichen oder privaten Alltag: Verschwörungserzählungen stellen eine echte Herausforderung dar. Was aber sind Verschwörungserzählungen und wie können sie erkannt und wirksam bearbeitet werden? Das Bildungsprogramm eröffnet einen dialogischen Gesprächsraum über aktuelle Fälle und Grundsätze pädagogischen Handelns im Umgang mit Verschwörungserzählungen. Theoretische Impulse sowie erprobte Zugänge und Methoden werden exemplarisch vorgestellt und in Gruppenarbeit diskutiert,
WEITERFÜHRENDER HINWEIS:
Die seit Jahrhunderten währende Kontinuität des Antisemitismus lässt sich nur auf Basis seiner spezifischen Eigenschaften begreifen. Das antisemitische Ressentiment weist ein hohes Maß an Wandelbarkeit sowie dynamischer Anpassungsfähigkeit auf, das jederzeit auf gesellschaftliche und intergenerational tradierte Abneigungen gegen Jüdinnen_Juden zurückgreifen kann. Der Mythos eines seit 1945 überwundenen Antisemitismus verdeckt die Stabilität des Phänomens in der postnationalsozialistischen Gesellschaft. Dieses bahnt sich immer wieder mithilfe neuer und sozial breit akzeptierter Ausdrucksformen den Weg bis hinein in ihre Mitte und manifestiert sich in unterschiedlichen Ausprägungen. Auch der israelbezogene Antisemitismus blickt auf eine lange Geschichte zurück, die nicht erst mit der Gründung des Staates Israel ihren Eingang findet. Alte antisemitisch aufgeladene Vorstellungen über Jüdinnen_Juden prägen den Blick auf den jüdischen Staat dabei in erheblicher Weise und äußern sich gewaltvoll. Das Bildungsprogramm »antisemitische Kontinuitäten am Beispiel des israelbezogenen Antisemitismus« lädt Teilnehmende dazu ein, sich mit Funktionen und Wirkungen dieser Dimension von Antisemitismus auseinanderzusetzen und je eigene Praxisbezüge auszuloten.
WEITERFÜHRENDER HINWEIS:
Antisemitismus wirkt als ›gewaltförmige Struktur‹ (Chernivsky/ Lorenz-Sinai 2020: 27) und Ungleichheitsverhältnis in allen Sozialräumen und Institutionen. Auch wenn eine entsprechende Thematisierung kürzlich Eingang in die fachwissenschaftliche Debatte gefunden hat, gibt es einen großen Bedarf an weiterer Diskussion und an der Weiterentwicklung des professionellen Umgangs mit Antisemitismus in den Handlungsfeldern Sozialer Arbeit. Diese Notwendigkeit ergibt sich sowohl aus dem Berufsethos als auch aus dem Selbstverständnis der Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession. Das Bildungsprogramm stärkt Akteur*innen der Sozialen Arbeit darin, ihre eigenen Positionen zu hinterfragen, ihre Wissensbestände neu zu ordnen, Mechanismen und Funktionen von Antisemitismus zu erkennen und seine Wirkung auf Betroffene in den Mittelpunkt zu rücken.
WEITERFÜHRENDE HINWEISE:
Die Relevanz einer Auseinandersetzung mit Antisemitismus in der Grundschule erschließt sich häufig nicht auf den ersten Blick. Sehr oft wird Antisemitismus auf den Nationalsozialismus und die Shoah reduziert und erscheint insbesondere für junge Kinder unzumutbar. Vor diesem Hintergrund gerät ein umfassenderes Verständnis von Antisemitismus und seine spezifische institutionelle Relevanz aus dem Blick. Wie jedes Gewalt- und Diskriminierungsverhältnis spiegelt sich aber auch Antisemitismus in der Grundschule und in der Lebenswelt von Kindern wider – direkter als häufig angenommen. (Wiegemann i. E. 2025) Wie tritt Antisemitismus in der Grundschule aktuell in Erscheinung? Wie wirkt Antisemitismus auf betroffene Kinder? Wie sieht ein professioneller Umgang mit Antisemitismus in der Grundschule aus? Welche pädagogischen Ansätze sollten strukturell stärker etabliert werden? Welche Chancen, aber auch welche Fallstricke bieten sie? Das Bildungsprogramm »Antisemitismus in der Grundschule« bietet Lehrkräften und anderen Multiplikator*innen die Möglichkeit, den Umgang mit Antisemitismus in der Grundschule zu reflektieren und zu professionalisieren.
WEITERFÜHRENDE HINWEISE:
Cheema, Saba-Nur/ Kleff, Sanem / Peek, Katinka Elisheva /Wiegemann, Romina (2023):
Fachgespräch »Inwiefern ist Antisemitismus ein Thema für die Grundschule?«
in: Digitales Fachforum: Antisemitismus in der Grundschule
Wiegemann, Romina (2025): Antisemitismuskritik in der Grundschule- Historische, institutionelle und
pädagogische Perspektiven.
in: Diehm, Isabell/ Braband, Janne / Cheema, Saba-Nur/ Körber, Karen / Körs, Anna / Kunze, Susanna /
Rensch-Kruse, Benjamin (Hrsg.): Antisemitismus in pädagogischen Kontexten. Differenzkonstruktionen
in Bildungseinrichtungen der frühen und mittleren Kindheit, Verlag transcript. (Online: Open Access Format)
Ob Shoah und Nationalsozialismus Themen für den Grundschulunterricht sind, wird seit Jahrzehnten immer wieder diskutiert. Der Workshop greift diese Frage aus antisemitismuskritischer Perspektive auf und ergänzt sie um Erfahrungen und Perspektiven von Grundschüler*innen mit jüdischen Familienbiografien. Zugleich werden Herausforderungen und Potenziale einer antisemitismuskritischen Shoah Education in der Grundschule eruiert und im Hinblick auf Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern reflektiert. Das Angebot versteht sich als Ergänzung zum Bildungsprogramm »Antisemitismus in der Grundschule«
WEITERFÜHRENDER HINWEIS:
Wiegemann, Romina (2023): Die Thematisierung der Shoah in frühkindlicher Bildung und Erziehung
in: Ringvorlesung »Geschichte und Soziale Arbeit? / Perspektiven für eine geschichtssensible soziale Arbeit«
Antisemitismus in Kindertagesstätten ist eine vielschichtige Herausforderung, der noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Erfahrungen aus der Bildungsarbeit und der Beratung von betroffenen Familien weisen darauf hin, dass ein antisemitismus- und diskriminierungskritischer Blickwinkel auf die Einrichtungen frühkindlicher Bildung, der alle daran Beteiligten (Kita- und Trägerleitungen, Erzieher*innen, Eltern und Kinder) miteinschließt, dringend erforderlich ist. Antisemitismus zeigt sich in der Kita nicht nur in Form institutioneller Ein- und Ausschlusspraktiken, sondern tritt auch als bewusst und unbewusst wirkendes Gewaltverhältnis zu Tage. In der Identitätsentwicklung jüdischer Kinder spielen diese frühen Lebensjahre, in denen sie sich erstmalig Fragen nach Repräsentation, Differenz, Zugehörigkeit und Sicherheit stellen, eine entscheidende Rolle. Das Angebot bietet Fach- und Führungskräften aus Kindertageseinrichtungen die Gelegenheit einer antisemitismuskritischen Reflexion der bisherigen Arbeitsformen, mit dem Ziel, die pädagogischen und institutionellen Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln und Perspektiven der von Antisemitismus betroffenen Kinder und Familien in den Mittelpunkt zu stellen.
WEITERFÜHRENDE HINWEISE:
Wiegemann, Romina (2024): »Vielfalt statt Vorurteile: Antisemitismuskritische Bildung in der KiTa« (Folge 17)
in: Podcast »Demokratie und Vielfalt – Alle inklusive? Der KiTa-Podcast.«
Chernivsky, Marina / Lorenz, Friederike / Schweitzer, Johanna (2020): Antisemitismus im (Schul-)Alltag –
Erfahrungen und Umgangsweisen jüdischer Familien und junger Erwachsener.
in: Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment, Berlin.
Die (pädagogische) Auseinandersetzung mit historisch und gesellschaftlich relevanten Themen mit Kindern und Jugendlichen wird häufig durch entsprechende Bücher unterstützt. So befasst sich ein mittlerweile beachtliches Spektrum an Kinder- und Jugendliteratur mit dem Nationalsozialismus und der Shoah. Ebenso bilden sich die Bemühungen, Kindern und Jugendlichen die religiöse Dimension des Judentums zu vermitteln, in zahlreichen Büchern ab. Dass Thematisierungen der Vergangenheit sowie die Vermittlung von Wissen über das Judentum nicht ausreichen, um aktuellen Antisemitismus zu bearbeiten, sind Erkenntnisse aus der Antisemitismuskritik bzw. der antisemitismuskritischen Bildung, die allmählich auch in den breiteren pädagogischen Diskurs eingehen. Umso deutlicher zeigt sich die Leerstelle einer hinreichenden Thematisierung gegenwärtiger Manifestationen antisemitischer Ressentiments und Gewaltpraxen in Kinder- und Jugendbüchern. Vereinzelte literarische Versuche, Erfahrungen von jüdischen Kindern und Jugendlichen exemplarisch aufzugreifen, können diese nicht hinreichend schließen – besonders dann nicht, wenn sie sich nicht an der Wirkungsgeschichte der Shoah und des Nationalsozialismus sowie der Kontinuität von Antisemitismus als gesamtgesellschaftliche und institutionelle Herausforderung orientieren. Das Bildungsprogramm »Antisemitismuskritik für die Kinder- und Jugendbuchliteratur« unterstützt Pädagog*innen, Eltern, Bezugspersonen und weitere Interessierte dabei, Bücher für Kinder und Jugendliche aus antisemitismuskritischer Perspektive einzuordnen und für die jeweiligen (pädagogischen) Ziele entsprechend auszuwählen.
WEITERFÜHRENDER HINWEIS:
Wiegemann, Romina (2022): Der Umgang mit Antisemitismus in Schulen (und Kindergärten) und
antisemitismuskritische Kinderbücher.
in: Podcast »Diverse Kinderbücher« von Buuu.ch
Antisemitismus ist strukturell in alle gesellschaftlichen Bereiche tief eingelassen, so auch in Kunst und Kultur. Tradierte Versatzstücke antisemitischer Ideologie prägen daher auch progressive und sich als diskriminierungskritisch verstehende Räume. Ein historisierendes oder anderweitig verkürztes Verständnis von Antisemitismus in Institutionen führt immer wieder zu problematischen Umgangsweisen und der Ausblendung jüdischer Perspektiven. Menschen, die Antisemitismus erfahren oder kritisieren, geraten nicht selten in die Defensive. Ein adäquater Umgang mit Antisemitismus setzt, wie jeder Umgang mit Gewalt- und Diskriminierungsverhältnissen, eine Auseinandersetzung voraus, die die jeweilige Erfahrungsdimension einschließt. Das Bildungsprogramm »Antisemitismus in Kunst und Kultur« bietet Interessierten aus dem Tätigkeitsfeld die Möglichkeit, sich (selbst-)reflexiv mit Antisemitismus als Erfahrung und Struktur auseinanderzusetzen und den Umgang damit zu professionalisieren.
WEITERFÜHRENDER HINWEIS:
Chernivsky, Marina / Fegert, Jonas (2024): ERINNERUNGSFUTUR
in: The DialoguePerspectives Podcast.
Neueste Studien zu Betroffenenperspektiven verweisen darauf, dass es gerade in Kontexten der (pädagogischen) Vermittlung von Nationalsozialismus und Shoah, sei es in der Schule oder an Gedenkstätten, verstärkt zur Reaktivierung antisemitischer Projektionen kommt (vgl. Chernivsky / Lorenz-Sinai 2022). Die Auseinandersetzung mit dem historischen Erbe des Nationalsozialismus und der Shoah fördert strukturelle antisemitische Kontinuitäten zutage, die bis in die Gegenwart wirken. Ein Umgang damit ergibt sich nicht von allein. Die Entwicklung einer professionellen antisemitismuskritischen Haltung, an die geeignete Interventionen geknüpft werden können, ist daher für Institutionen historischpolitischer Bildung und ihre Fachkräfte von besonderer Relevanz. Das Bildungsprogramm »Antisemitismus an Gedenkstätten« will daher nicht nur zur klassischen Wissenserweiterung im Hinblick auf die Dimensionen von Antisemitismus, seiner Funktionen und Wirkungen beitragen. Durch einen selbst- und gesellschaftsreflektierenden Zugang werden außerdem die eigene Wahrnehmungs-, Deutungs- und Handlungskompetenz im pädagogischen Umgang mit Antisemitismus an Gedenkstätten gefördert.
WEITERFÜHRENDE HINWEISE:
Chernivsky, Marina / Lorenz-Sinai, Friederike (2022): »Keine schwerwiegenden Vorfälle« – Deutungen
von Antisemitismus durch pädagogische Teams an Gedenkstätten zu ehemaligen Konzentrationslagern
in: ZRex – Zeitschrift für Rechtsextremismusforschung, Jg. 2, H. 1, S. 22–40.
Antisemitismus ist strukturell in alle gesellschaftlichen Bereiche eingewoben. So finden sich auch in der Berichterstattung antisemitische Manifestationen in der Sprache, die die gesamtgesellschaftliche Wahrnehmung von und den Umgang mit Antisemitismus wechselseitig beeinflussen. Ein historisierendes Verständnis von Antisemitismus kann hierbei zu problematischen Verzerrungen führen, insbesondere wenn gegenwärtige Ausprägungen des Antisemitismus sowie seine Funktionen und die Wirkung auf die Betroffenen ausgelassen werden. Ein adäquater Umgang mit Antisemitismus bei Medienschaffenden schließt, wie jeder Umgang mit Gewalt- und Diskriminierungsverhältnissen, die Reflexion über gegenwärtige Dimensionen von Antisemitismus und die eigene Erfahrungsdimension mit ein. Das Programm lädt Medienschaffende und weitere Interessierte dazu ein sich selbstreflexiv und dialogorientiert mit Antisemitismus als Struktur und Erfahrung auseinanderzusetzen und ihren Umgang damit zu professionalisieren.
LITERATURHINWEIS:
Mit der Formulierung antisemitismuskritischer Perspektive hat sich der Diskurs um Antisemitismus und Bildung weitgehend aktualisiert. Der Begriff der Antisemitismuskritik ergibt sich aus dem Grundgedanken der Kritischen Theorie und erkennt die Notwendigkeit selbstkritischer Reflexivität im Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit an. Zentral ist die Erkenntnis, dass Antisemitismus als Macht- und Strukturverhältnis das Denken und Handeln der gesamten Gesellschaft durchdringt und das Individuum antisemitisches Wissen als Teil seiner Sozialisierung erlernt. Die Bezeichnung »antisemitismuskritische Bildung« umfasst eine Vielzahl von Bildungsansätzen, die auf einer gemeinsamen Basis beruhen. Der Kritikbegriff problematisiert die Konstanz, aber auch die Abwehr des Antisemitismus, problematisiert seine Externalisierung und geht explizit auf die Bagatellisierung jüdischer Perspektiven ein. Antisemitismuskritische Bildung richtet sich zudem nicht ausschließlich an Jugendliche, sondern auch an Erwachsene, die in ihren professionellen Rollen angesprochen und in Fort- und Weiterbildungen sensibilisiert und geschult werden sollen. Das Programm lädt historisch-politischer Bildner*innen, Lehrkräfte, Multiplikator*innen, sowie andere Interessierte dazu ein, sich mit den Grundsätzen und Qualitätsmerkmalen antisemitismuskritischer Bildung auseinanderzusetzen und den Umgang mit Antisemitismus in der Bildungspraxis weiterzuentwickeln.
WEITERFÜHRENDE HINWEISE:
Chernivsky, Marina (2023): Qualitätsmerkmale antisemitismuskritischer Bildung. in: Kompetenzzentrum für antisemitismuskritische Bildung und Forschung im Rahmen des Kompetenznetzwerks Antisemitismus, Berlin.
Wiegemann, Romina / Vasmer, Alexander (2025 i. E.): »Vielleicht hätte es mehr Empathie für die Juden hier gegeben, wenn…«. Herausforderungen antisemitismuskritischer Bildungsarbeit mit Erwachsenen nach dem 7. Oktober. in: Gutfleisch, Henning / Hermert, Alexander / Rajal, Elke / Schubert, Kai / Walter, Vanessa (Hrsg.): Grenzen der Erfahrung. Gesellschaftskritische Perspektiven auf Antisemitismus und Bildung. Wochenschau Verlag.