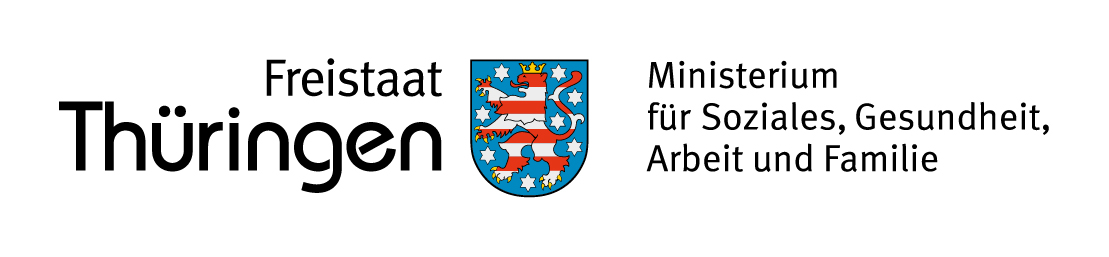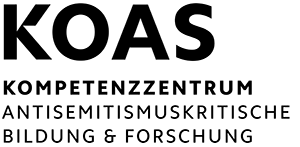Perspektivwechsel – Praxisstelle Thüringen

Das Projekt »Perspektivwechsel – Praxisstelle Thüringen« ist die Zweigstelle des Kompetenzzentrums antisemitismuskritische Bildung und Forschung (KOAS) im Freistaat Thüringen. Seit 2007 bietet das Projekt Bildungsmaßnahmen für zivilgesellschaftliche Organisationen, Schulen, Hochschulen, öffentliche Verwaltung, Polizei. Das Projekt will dazu beitragen, den Umgang mit Antisemitismus und Diskriminierung in Institutionen auszubauen und die Kompetenz von Fach- und Führungskräften durch gezielte Bildungs-und Beratungsmaßnahmen auszuweiten.
In einer Zeit, in der politische Umwälzungen, gesellschaftliche Spannungen und Gewaltpotenziale gegen Minderheiten zunehmen, ist die Arbeit der Praxisstelle Thüringen wichtiger denn je. Unser Ziel ist es, den Umgang mit Gewalt und Diskriminierung zu fördern – in Bildungseinrichtungen Behörden, sozialen Einrichtungen und darüber hinaus.
Wie arbeiten wir?
Unsere Bildungsangebote basieren auf dem projekteigenen Dialogischen Reflexionsansatz (DiRA; Chernivsky 2014) und dem Anti-Bias-Ansatz (Derman-Sparks/Brunson-Philips). Ziel der beiden Ansätze ist es, eine selbstreflexive, erfahrungsbasierte und gesellschaftskritische Auseinandersetzung mit Dominanzkulturen, Macht und Diskriminierung zu ermöglichen und das Bewusstsein für den Fortbestand von Antisemitismus, Rassismus und anderen Gewaltverhältnissen zu erhöhen.
Unsere Angebote
Die Angebote werden in der Regel auf Anfrage entwickelt und auf die Bedarfe der jeweiligen Handlungs- und Berufsfelder der Zielgruppen zugeschnitten. Das Projektangebot bietet verschiedene Formate der Fort- und Weiterbildung an:
Die inhaltliche Schwerpunktsetzung wie auch die Dauer und Struktur der Angebote werden bedarfsorientiert entwickelt und zielgruppenspezifisch umgesetzt. Bei langfristig angelegten und modular aufgebauten Bildungsprogrammen hat sich eine Dauer von mehreren zweitägigen Modulen als wirkungsvoll erwiesen.
Alle Angebote des Projekts sind für die Teilnehmenden kostenfrei.
Beispiele für unsere Veranstaltungen
Die Angebote werden flexibel gestaltet und an die spezifischen Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst. Sie variieren in Inhalt, Dauer und Struktur je nach Anfrage und Anforderungen. Erfahrungsgemäß haben sich Programme mit fünf zweitägigen Modulen als besonders effektiv erwiesen.
Kontakt
Vera Katona
Co-Projektleitung
katona[at]koas-bildungundforschung.de
René André Bernuth
Co-Projektleitung
bernuth[at]koas-bildungundforschung.de
Förderer