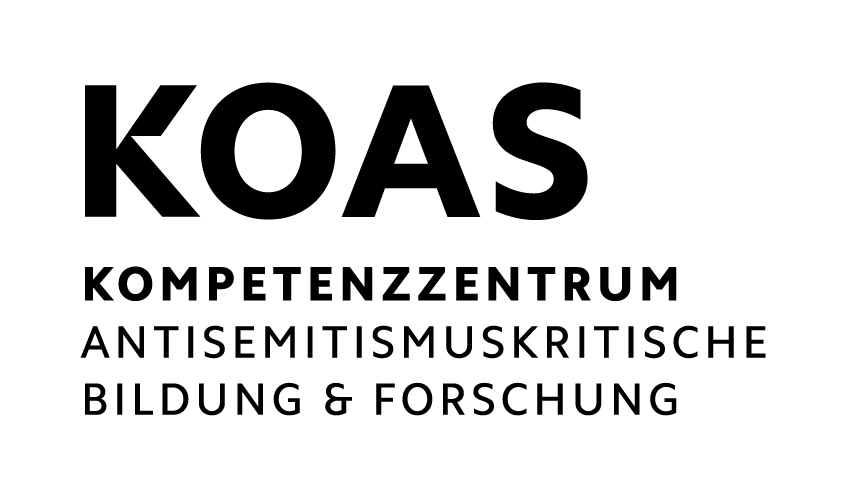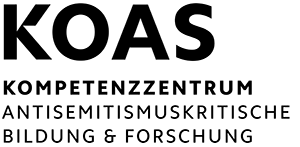Forschung
Forschungsbereich des Kompetenzzentrum antisemitismuskritische Bildung und Forschung (KOAS) Geschichte
Mit der Veröffentlichung des zweiten Antisemitismusberichts des Deutschen Bundestages ist die Lücke in der Forschung zu jüdischen Perspektiven auf Antisemitismus hervorgetreten. 2017 hat das Kompetenzzentrum die erste bundesweite Studie zu Antisemitismuserfahrungen jüdischer Familien an deutschen Schulen initiiert und konzipiert. Im Jahr 2018 gründeten Marina Chernivsky und Prof. Dr. Friederike Lorenz-Sinai den Forschungsbereich, der seit 2021 in fester Forschungskooperation mit der Fachhochschule Potsdam Forschungsprojekte umsetzt. Mit der Gründung des neuen Forschungsbereichs reagierte das Kompetenzzentrum auf Bedarfe an empirischer Forschung zu Antisemitismus aus jüdischen Perspektiven und dem Umgang mit Antisemitismus in Institutionen. Das Ziel der Forschung sind empirische Studien zum Umgang mit und Folgen von Antisemitismus in der Gegenwartsgesellschaft. Das Erkenntnisinteresse der aktuell laufenden Studien betrifft die Deutungen und Wahrnehmungen von Antisemitismus aus jüdischen und nichtjüdischen Perspektiven sowie die institutionellen Praktiken in den Handlungsfeldern der Schule, Sozialen Arbeit, Gedenkstättenpädagogik, Polizei und Verwaltung. Laufende Studien umfassen die Bundesländerstudienreihen zu „Antisemitismus im Kontext Schule“ und „Antisemitismus im Kontext der Polizei“ sowie die bundesweite Studie zu Auswirkungen des 7. Oktober 2023 auf die jüdische und israelische Community in Deutschland.
LITERATURHINWEIS:
Deutscher Bundestag (2017): Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus. Drucksache 18 / 11970: https://dserver.bundestag.de/btd/18/119/1811970.pdf [zuletzt aufgerufen am 18.08.2025]
Grundlagen der Forschung
Methodologisch wird mit praxeologischen sowie prozessual-gewaltsoziologischen Zugängen gearbeitet, um Routinen, Praktiken und die soziale Aushandlung des Antisemitismus in institutionellen Machtverhältnissen zu ergründen. Für die Forschung zu Antisemitismus aus jüdischen Perspektiven sind zudem Fragen nach den Selbstthematisierungen in Differenz zu dominanzgesellschaftlichen Fremdthematisierungen sowie die theoretischen Konzepte der Kollektivbiografie und kollektiven Gewalt zentral.
Methodisch wird mit Erhebungs- und Auswertungsverfahren der interpretativen und rekonstruktiven Sozialforschung gearbeitet (vgl. Rosenthal 2015).
Das Erkenntnisinteresse der Studien zu Antisemitismus in verschiedenen Kontexten (Schule, Gedenkstätten, Polizei) richtet sich einerseits auf die (lern-)biografisch geprägten Verständnisse von sowie Umgangsweisen mit Antisemitismus durch (pädagogische) Fachkräfte (Lehrkräfte, Erzieher*innen, Schulsozialarbeiter*innen, pädagogische Fachkräfte an Gedenkstätten, Polizeibeamt*innen und Polizist*innen). Andererseits bezieht sich die Forschung zu Betroffenenperspektiven auf die empirische Analyse von Erfahrungen, Deutungen und Umgangsweisen der jüdischen und israelischen Communities sowie die kollektivbiografische Bedeutung antisemitischer Strukturen.
In der Forschung zu Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen sehen wir uns in allen Phasen der Forschung in besonderem Maße der Forschungsethik verpflichtet. Im Umgang mit Forschungsteilnehmer*innen und in der Gestaltung von Erhebungssituationen orientieren wir uns an ethischen Prinzipien und Erfahrungen, die in den letzten Jahrzehnten in der Gewaltforschung etabliert wurden (vgl. Helfferich et al. 2016).
LITERATURHINWEISE:
Rosenthal, Gabriele (2015): Interpretative Sozialforschung. Eine Einführung. 5. aktualisierte und ergänzte Auflage. Weinheim, Basel: Beltz.
Helfferich, Cornelia / Kavemann, Barbara / Kindler, Heinz (2016): Forschungsmanual Gewalt. Grundlagen der empirischen Erhebung von Gewalt in Paarbeziehungen und sexualisierter Gewalt. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Forschungsteam
Leitung Forschungsbereich
Diplom-Psychologin Marina Chernivsky (KOAS)
Prof. Dr. Friederike Lorenz-Sinai (FH Potsdam)
Forschungsteam
Sophia Hoppe, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Studienkoordinatorin (KOAS)
Dr. Hanne Balzer, wissenschaftliche Mitarbeiterin (FH Potsdam)
Ansprechpartnerin: Sophia Hoppe (hoppe[at]koas-bildungundforschung.de)