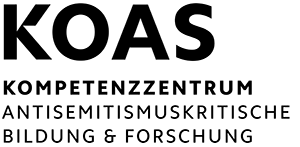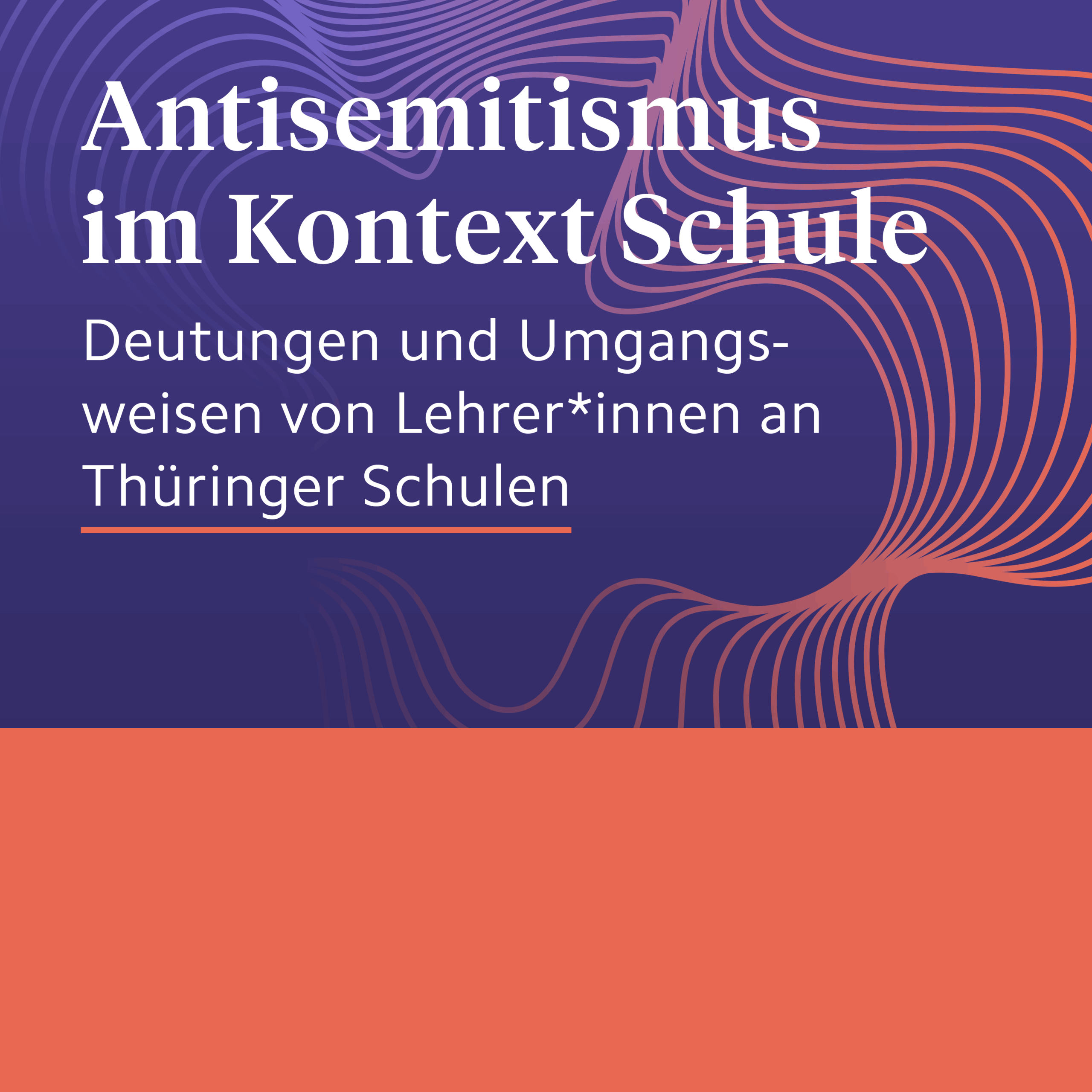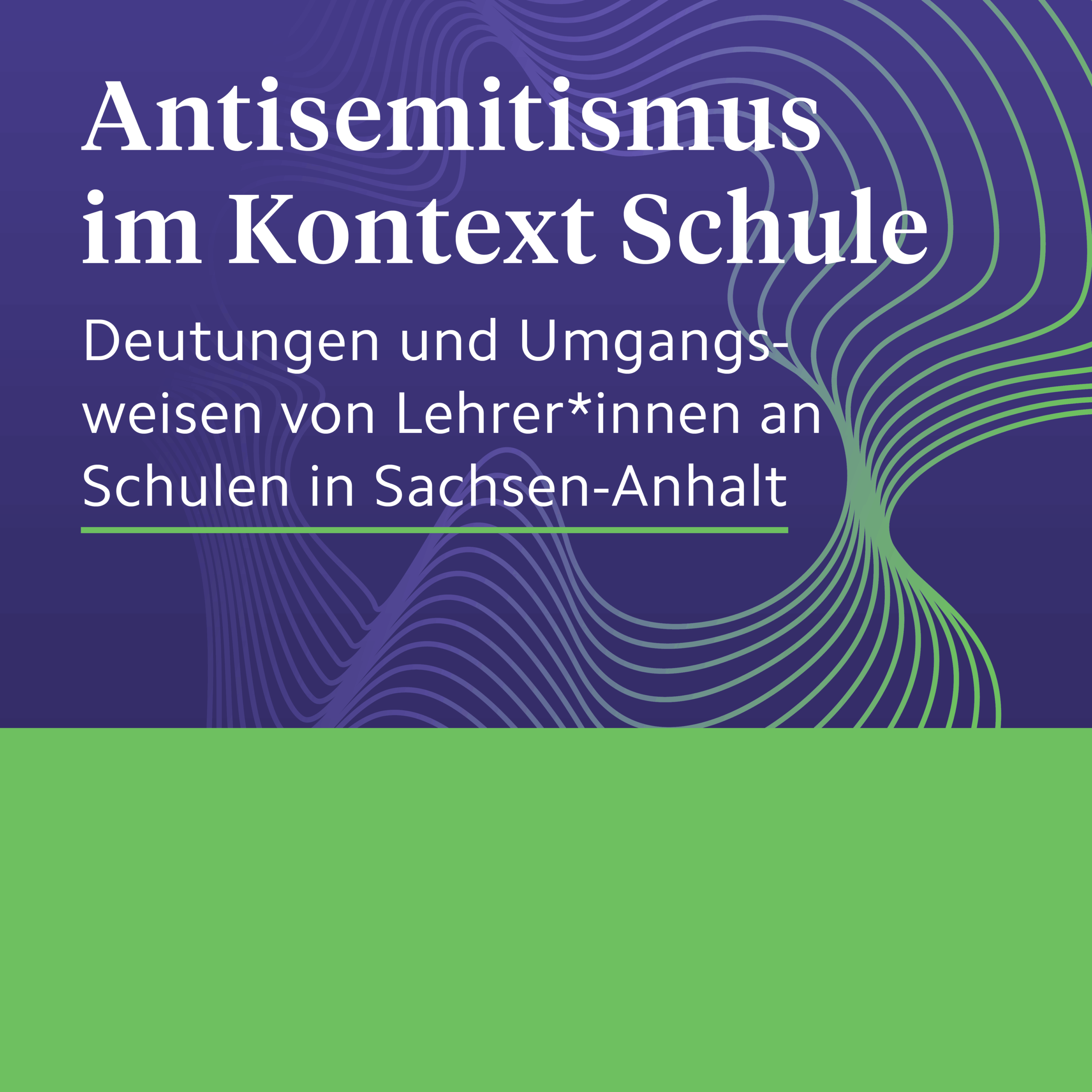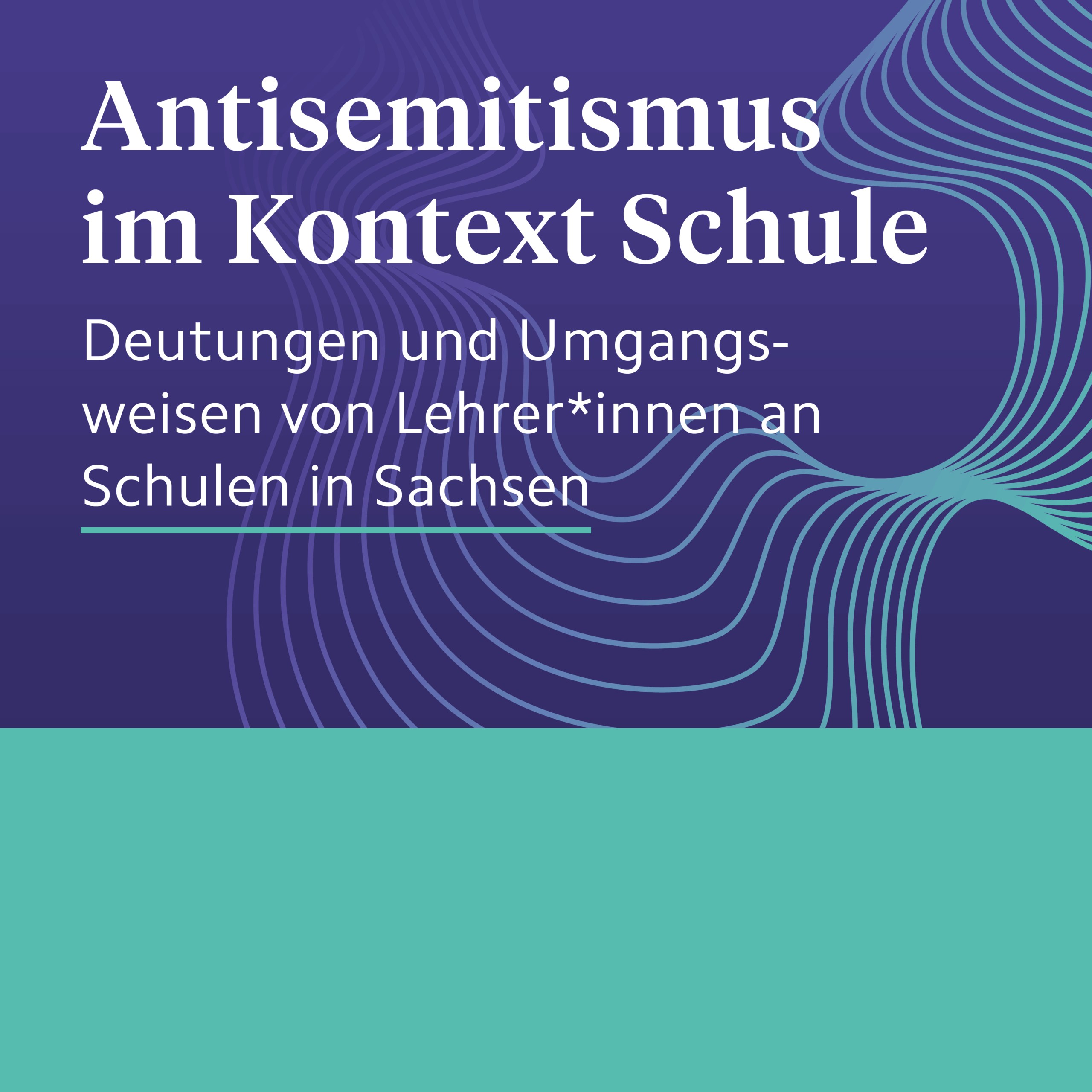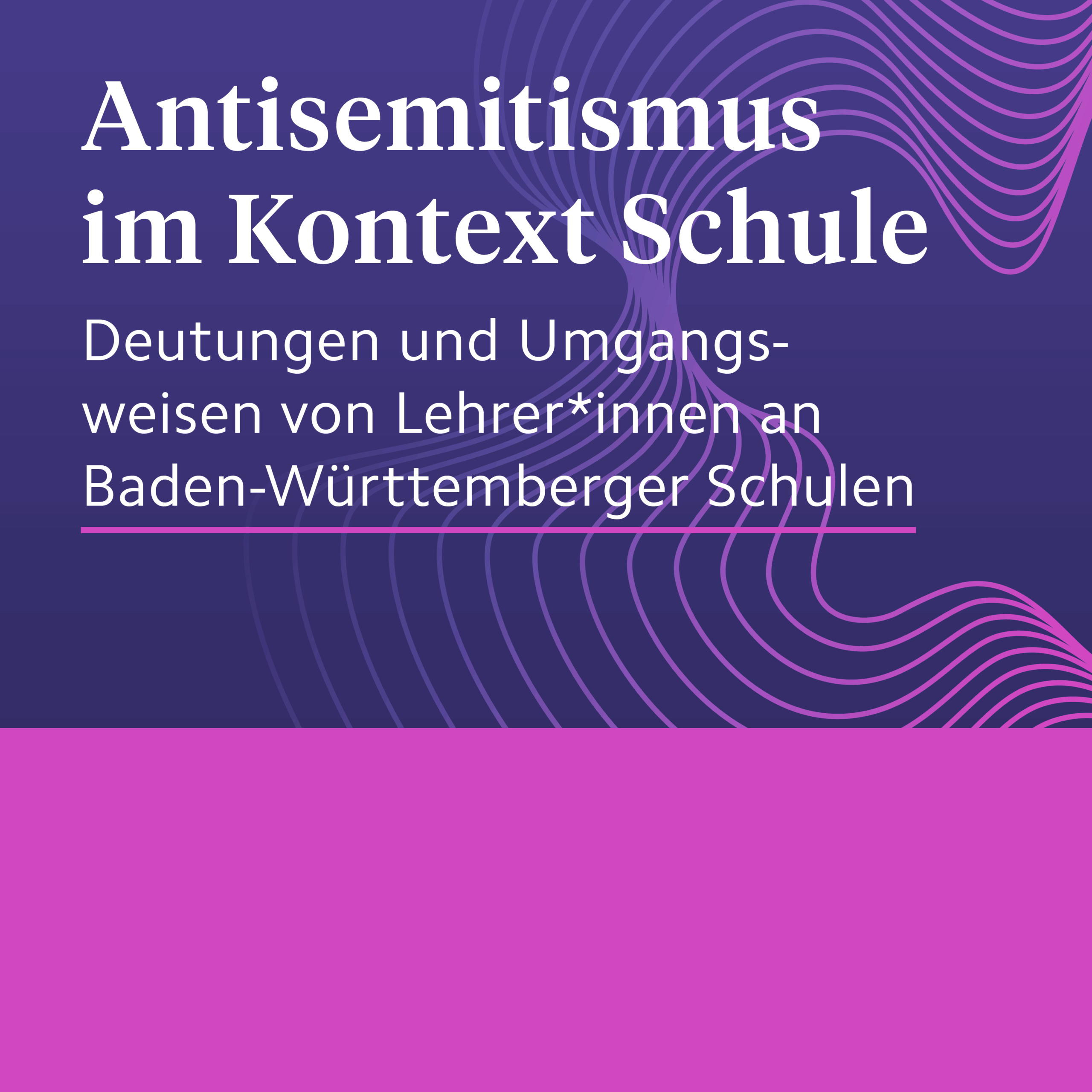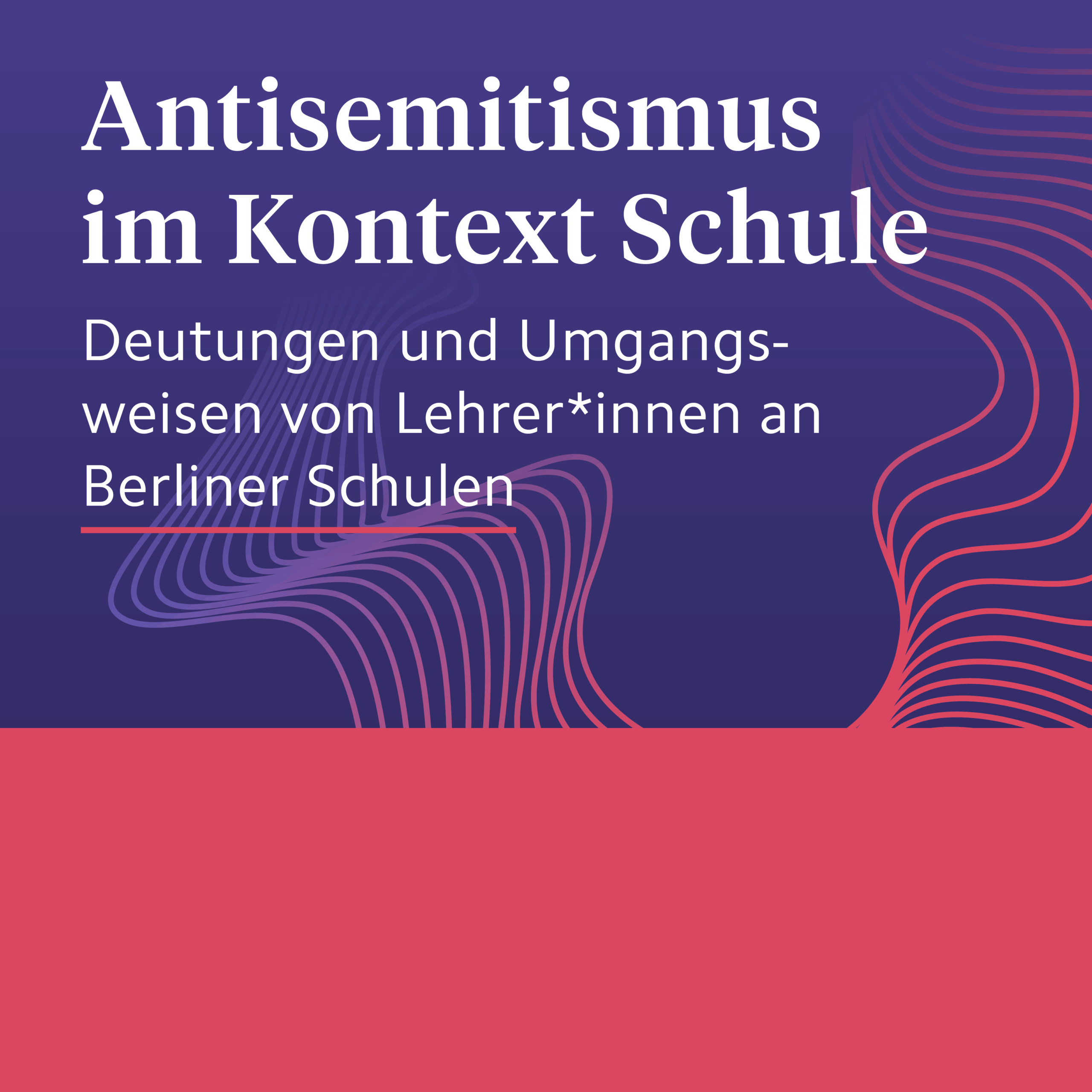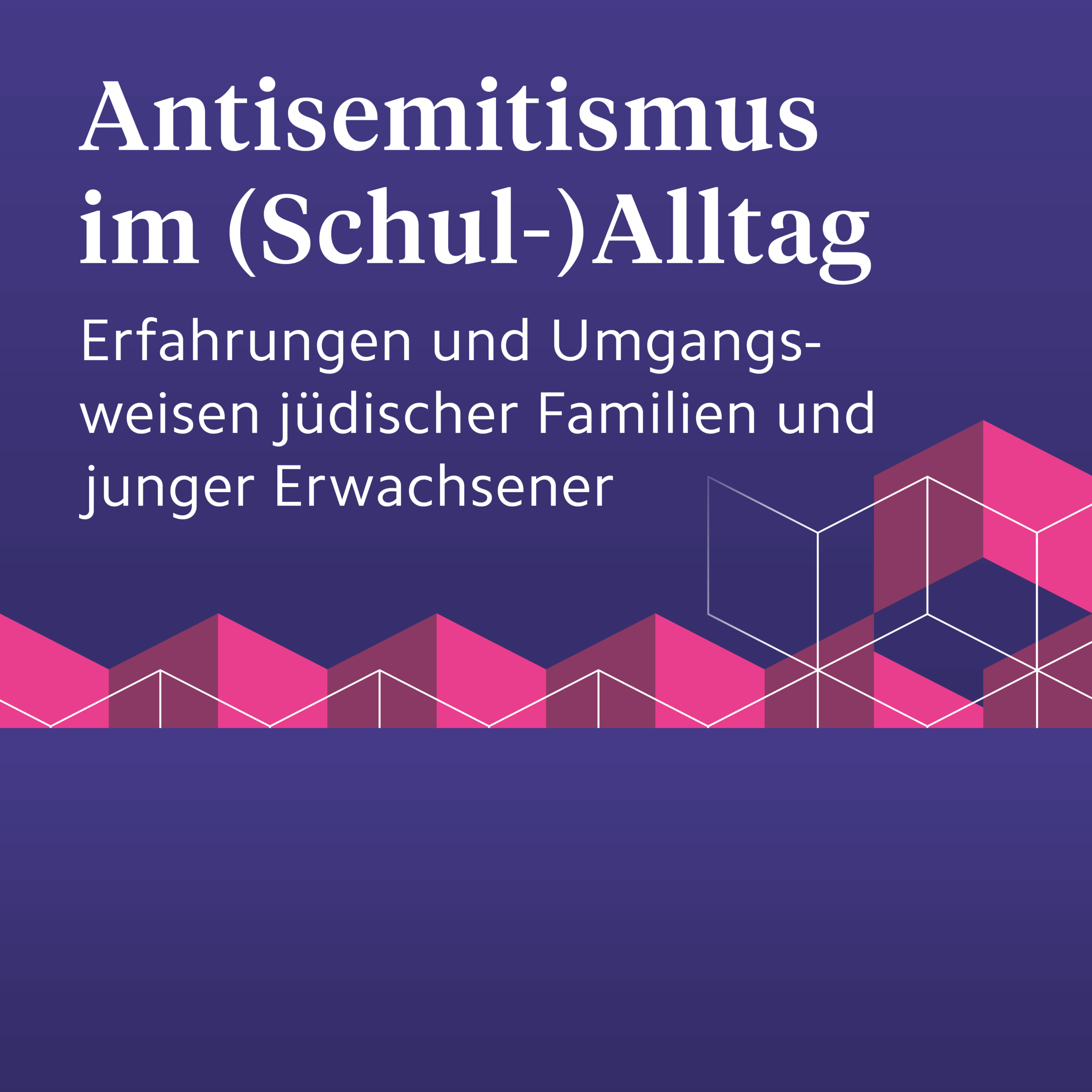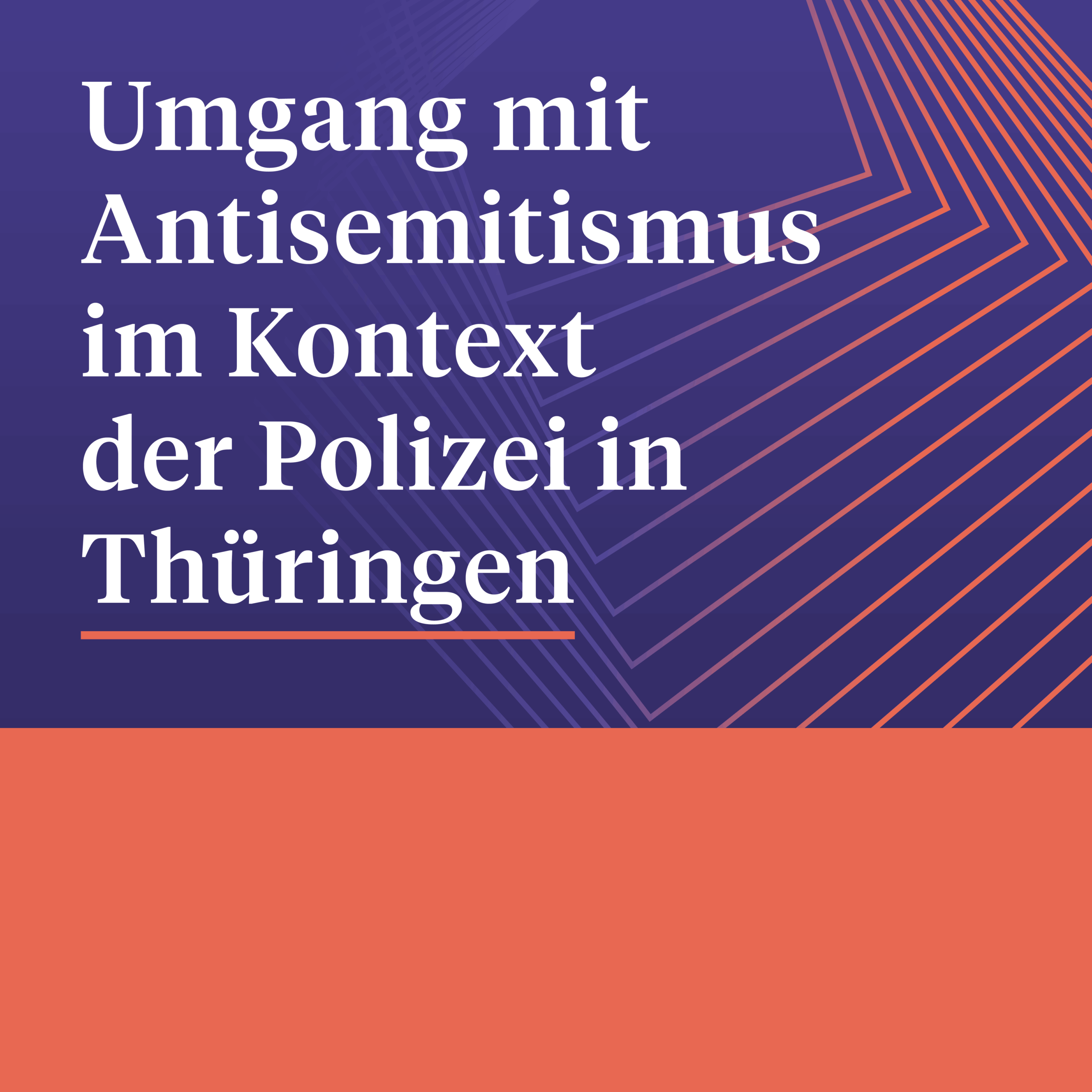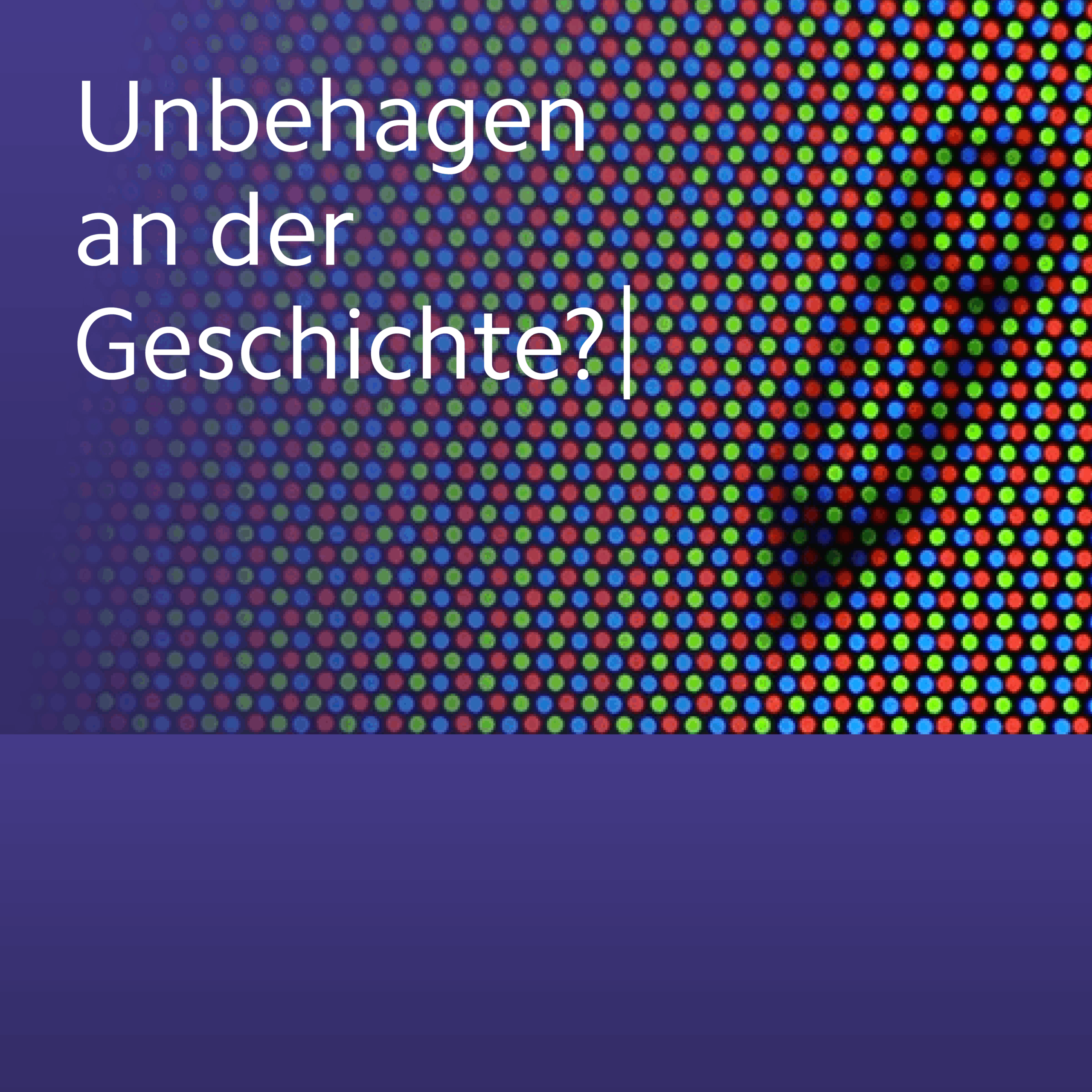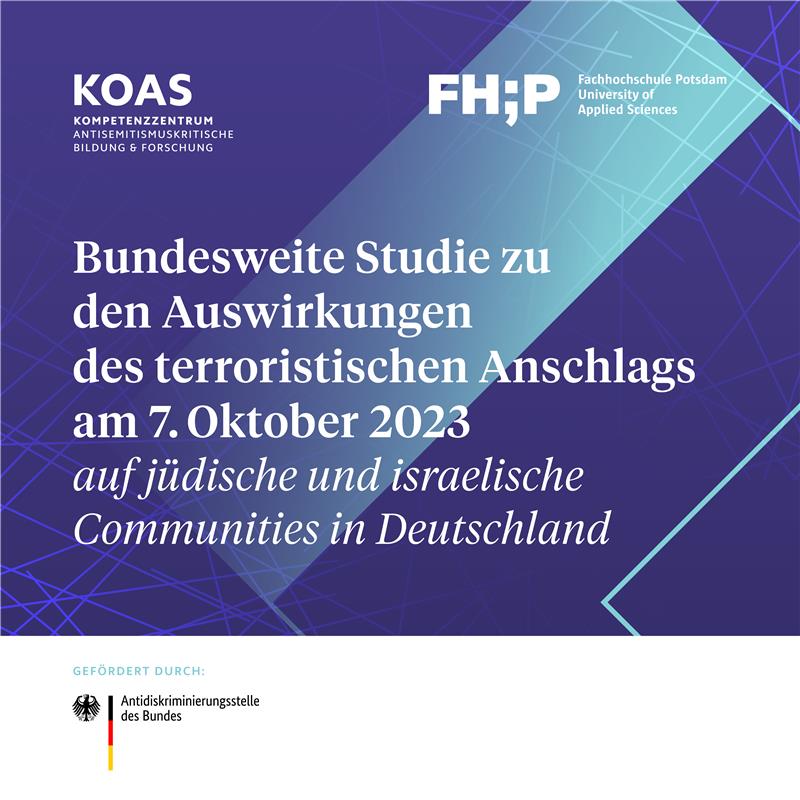Studien
Das Erkenntnisinteresse der seit dem Jahr 2018 laufenden Bundesländerstudienreihe »Antisemitismus im Kontext Schule« betrifft die lebensgeschichtlichen Erzählungen und darin liegenden Deutungen und Verständnisse von Antisemitismus sowie die narrativen Praktiken zum Umgang mit Antisemitismus an Schulen. In der Studienreihe untersuchen wir die Forschungsfragen, wie Antisemitismus im Laufe von (Schul-)Biografien in Erscheinung tritt und durch (ehemalige) jüdische Schüler*innen, Lehrer*innen, Schulleitungen, Schulsozialarbeiter*innen sowie Expert*innen aus der Bildungspolitik der jeweiligen Bundesländer wahrgenommen, eingeordnet und bearbeitet wird. Auf der methodischen Grundlage der interpretativen und rekonstruktiven Sozialforschung werden narrative Einzelinterviews sowie Gruppendiskussionen durchgeführt und durch Codierung und Sequenzanalysen in Interpretationsrunden analysiert. Die Erhebungssituationen werden entlang von forschungsethischen Prinzipien und Erfahrungen aus der institutionenbezogenen und subjektorientierten Gewaltforschung gestaltet.
Die Bundesländerstudienreihe wird am Forschungsbereich des Kompetenzzentrums antisemitismuskritische Bildung und Forschung (KOAS) in Kooperation mit der Fachhochschule Potsdam unter wissenschaftlicher Leitung von Dipl-Psych. Marina Chernivsky und Prof. Dr. Friederike Lorenz-Sinai umgesetzt. Bisher wurden fünf bundeslandbezogene Studien in Berlin, Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen durchgeführt. Die Studienreihe ermöglicht die systematische Analyse und den Vergleich von bundeslandspezifischen und länderübergreifenden Praktiken und Strukturmerkmale des Umgangs mit Antisemitismus an Schulen aus den Perspektiven jüdischer und nichtjüdischer Akteur*innen.
Insgesamt haben bisher (Stand: September 2025) 139 Personen an den fünf bundeslandbezogenen Studien teilgenommen:
- 44 Teilnehmende in Baden-Württemberg; davon: 9 (ehemalige) Schüler*innen, 28 Lehrkräfte, 7 Expert*innen;
- 20 Teilnehmende in Sachsen-Anhalt; davon: 5 (ehemalige) Schüler*innen, 8 Lehrkräfte, 7 Expert*innen;
- 18 Teilnehmende in Thüringen; davon: 1 (ehemalige*r) Schüler*in, 14 Lehrkräfte, 3 Expert*innen;
- 28 Teilnehmende in Sachsen; davon: 5 (ehemalige) Schüler*innen, 19 Lehrkräfte, 4 Expert*innen und
- 29 Teilnehmende in Berlin; davon: 4 Schulleitungen, 9 Expert*innen, 10 Einzelinterviews mit Lehrkräften und 5 Gruppendiskussionen mit jeweils drei bis sechs Lehrkräfte, ergänzend je eine Fachkraft aus der Schulsozialarbeit und der schulpsychologischen Beratung.
Aktuell werden weitere bundeslandbezogene Studien im Rahmen der Bundesländerstudienreihe geplant.
Zusätzlich zu der Studienreihe »Antisemitismus im Kontext Schule« wurde in den Jahren 2017 – 2019 eine weitere Studie durchgeführt, welche die Erfahrungen und Umgangsweisen jüdischer Familien und junger Erwachsener mit Antisemitismus im (Schul-)Alltag erhob. An dieser Studie nahmen Personen aus Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern teil. Interviewt wurden 10 junge Erwachsene, 5 Elternteile schulpflichtiger Kinder, 2 Lehrkräfte sowie eine Familie in einem Gruppeninterview (vgl. Chernivsky / Lorenz / Schweitzer 2020).
Auf Grundlage dieser Erhebungen konnten Strukturmerkmale des Umgangs mit Antisemitismus im institutionellen Kontext von Schulen in Deutschland analysiert werden. Bundesländerübergreifend zeigen die Datenanalysen, dass nichtjüdische Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter*innen Antisemitismus zu Beginn ihrer Interviewerzählungen und Gruppendiskussionen überwiegend als ein Thema einordnen, dass sie aus einer großen Distanz, als primär historisches Thema und mit wenig Bezug zur eigenen (schulischen) Biografie und Lebenswelt wahrnehmen. Im Laufe der Interviewnarration werden zunehmend Momente der biografischen Einsozialisation in antisemitische Praktiken und Wissensbestände erinnert. In den Schilderungen von Erfahrungen aus dem Schulalltag werden mehrere bundeslandübergreifende verbreitete Praktiken des Umgangs mit Antisemitismus sowie der Legitimation deutlich. Das Ausmaß des Antisemitismus an der eigenen Schule wird an jüdische Anwesenheit geknüpft. Lehrkräfte gehen oftmals von jüdischer Nichtpräsenz aus und leiten daraus die Annahme ab, es gäbe auch kein Antisemitismusproblem an der Schule. Werden antisemitische (Sprach-)Handlungen im schulischen Raum oder in Chatgruppen beobachtet, werden diese als vorübergehende pubertäre Provokation, als Ausdruck fehlenden Wissens oder als ein Problem bestimmter Schüler*innengruppen gedeutet. Die geschilderten Interventionen richten sich in der Regel ausschließlich an antisemitisch handelnde Schüler*innen und sind nicht betroffenenorientiert ausgerichtet. Jüdische Schüler*innen und ihre Familien werden kaum thematisiert und bei Interventionen nicht mitgedacht. Insgesamt beschreiben sich Lehrkräfte im Umgang mit Antisemitismus als eingeschränkt handlungsfähig und sehen sich vonseiten der Schulleitungen und der übergeordneten Behörden oftmals als wenig unterstützt.
Jüdische (ehemalige) Schüler*innen berichten bundesländerübergreifend von antisemitischen Erfahrungen seit der frühen Grundschulzeit. Sie lernen, ihre jüdische Identität im schulischen Kontext eher zurückzuhalten. Die interviewten Jugendlichen und jungen Erwachsenen schildern kollektive Erfahrungen des Othering durch Mitschüler*innen und Lehrkräfte sowie der Exotisierung und Objektifizierung im Unterricht durch die Adressierung als Expert*innen bei jüdisch assoziierten Themen. Weiterhin beschreiben sie eine Normalität antisemitischer Alltagssprache durch Mitschüler*innen im Schulkontext. Sie erinnern Relativierungen durch Lehrkräfte sowie ausbleibende Reaktionen, Passivität und Indifferenz. Einige der jüdischen Interviewpartner*innen berichten von Übergriffen im Schulalltag.
Der Vergleich der Daten verweist auf eine strukturelle Perspektivendivergenz auf Antisemitismus im Kontext Schule und deutet auf institutionelle Leerstellen im Umgang mit antisemitischen Vorfällen und Strukturen hin. Zwischen den Bundesländern zeigen sich hohe Parallelen hinsichtlich der Deutungen und Unterschiede hinsichtlich der Einbettung des Antisemitismus in rechtsextreme Orientierungen sowie hinsichtlich des israelbezogenen Antisemitismus. Deutlich wird zudem, wie die unterschiedlichen antisemitismusbezogenen Maßnahmen der Bundesländer von Lehrkräften wahrgenommen werden.
Als Handlungsimpulse lassen sich exemplarisch folgende Bedarfe ableiten, um den Entwicklungen des institutionellen Antisemitismus an Schulen entgegenzuwirken:
- Antisemitismus als Professionalisierungsaufgabe für Schulen begreifen
- Möglichkeiten der kollegialen Beratung, Supervision, Fort- und Weiterbildung etablieren
- Entwicklung eines strukturellen (statt eines vorfallsbezogenen) Antisemitismusverständnis
- Betroffenenorientierte Schutz- und Beschwerdewege ausbauen und implementieren
- Die antisemitismuskritische Unterrichtspraxis fachübergreifend weiterentwickeln und implementieren
- Antisemitismuskritische Perspektiven systematisch in die Lehrer*innenbildung integrieren und in den Strukturen der berufsbegleitenden Weiterbildung verankern
Weiterführende Literatur:
Chernivsky, Marina/ Lorenz-Sinai Friederike (2024):
Institutioneller Antisemitismus in der Schule.
Baustein 14, Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage. Aktion Courage e.V., Berlin.
Chernivsky, Marina / Lorenz-Sinai, Friederike (2023):
Antisemitismus im Kontext Schule. Deutungen und Praktiken von Lehrkräften.
Weinheim: Beltz Juventa.
Chernivsky, Marina/ Lorenz-Sinai, Friederike (2023):
Antisemitismus in institutionellen Kontexten – Soziale Prozesse der Deutung und Einordnung.
Migration und Soziale Arbeit, Heft 1, S. 54-61.
Chernivsky, Marina/ Lorenz-Sinai, Friederike / Schweitzer, Johanna (2022):
Von Antisemitismus betroffen sein. Deutungen und Umgangsweisen jüdischer Familien und junger Erwachsener.
Weinheim: Beltz Juventa.
Chernivsky, Marina / Lorenz, Friederike (2020):
Antisemitismus im Kontext Schule. Deutungen und Umgangsweisen von Lehrer*innen an Berliner Schulen.
Forschungsbericht, Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment.
Chernivsky, Marina / Lorenz, Friederike / Schweitzer, Johanna (2020):
Antisemitismus im (Schul-)Alltag. Erfahrungen und Umgangsweisen jüdischer Familien und junger Erwachsener.
Forschungsbericht, Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment.